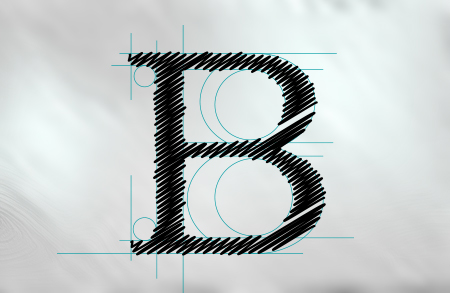
Die nächste Überlegung ist, ob beim Discounter möglichst preisgünstig „No-name-Produkte“ oder Aktionswaren eingekauft werden sollen, oder lieber ein Fachgeschäft – auch mit Beratung – aufgesucht wird. Dort werden in der Regel teurere Markenprodukte in einer besseren Qualität verkauft – wenn auch zu einem höheren Preis. Die Entscheidung für einen Einkauf hier oder dort wird auch von den Erfahrungen beeinflusst, die man mit den verschiedenen Produkten gemacht hat. Spontankäufe gibt es natürlich auch – je nach Haushalt, finanzieller Lage und eigenem Befinden mehr oder weniger oft.
Soll etwas Außergewöhnliches oder Besonderes angeschafft werden, informiert man sich umfassend über das gewünschte Produkt. Kriterien sind zum Beispiel die angebotenen Qualitäten, die Preise und die Bezugskonditionen oder Lieferbedingungen. Anhand dieser Aspekte werden verschiedene Anbieter verglichen. Dann wird derjenige ausgewählt, dessen Angebot den größten Nutzen verspricht.
Prinzipiell läuft nach diesem bewährten Muster auch die Beschaffungsplanung in einer Organisation ab – ob Industrieunternehmen, Handwerksbetrieb, Handelsgesellschaft, Behörde oder Verein, unabhängig von der Größe oder Branche.
Beschaffungsplanung – eine Begriffsbestimmung
Das Wort „Beschaffungsplanung“ beinhaltet die beiden Komponenten „Beschaffen“ als „Versorgen mit“ sowie „Planung“ als „zielgerichtete Gestaltung der Zukunft“.
Beschaffung
Im weitesten Sinn fallen unter den Begriff „Beschaffung“ alle Tätigkeiten und Vorkehrungen, die der Versorgung einer Organisation mit Mitteln zur Aufrechterhaltung der Funktion dienen. Dabei sind diverse Randbedingungen zu beachten, beispielsweise Aspekte wie Menge, Qualität, Kosten, Zeitvorgaben, Logistik und Ersatz.
Je nach Betrachtungsebene gibt es unterschiedliche Perspektiven, um die für die Funktion der Organisation notwendigen Mittel zu beschreiben:
- Aus volkswirtschaftlicher Sicht stehen die Produktionsfaktoren im Fokus, die ein Handeln im Wirtschaftsraum ermöglichen. Die klassische Unterscheidung in Boden, Kapital und Arbeit wird mittlerweile oft um den Faktor Wissen oder Information erweitert. Konkret handelt es sich bei den Produktionsfaktoren unter anderem um Grundstücksflächen und Gebäude, Maschinen und Anlagen sowie Personal und Know-how.
- Aus betriebswirtwirtschaftlicher Sicht handelt es sich um die sogenannten betrieblichen Produktionsfaktoren. Diese werden eingesetzt, um den störungsfreien Ablauf der Prozesse zum Erreichen der unternehmerischen Ziele zu gewährleisten und aufrechtzuerhalten. Elementarfaktoren sind die ausführende Arbeit, die Betriebsmittel und die Werkstoffe. Konkret handelt es sich beim Faktor Arbeit um das Personal mit seinen Fähig- und Fertigkeiten. Zum Faktor Betriebsmittel gehören die Gebäude und Anlagen inklusive deren Ausstattung zum Beispiel mit Maschinen und Geräten. Der Faktor Werkstoffe umfasst den „materiellen Input“ aus Ausgangsmaterialien und -produkten, Roh-, Betriebs- und Hilfsstoffen. Ergänzt werden sollte hier der „immaterielle Input“, also die Versorgung mit Wissen, Informationen sowie Rechten wie Lizenzen oder Patenten. Beachtet werden sollte zudem, dass in der Regel auch Dienstleistungen von externen Anbietern in Anspruch genommen – beschafft – werden; diese können der ausführenden Arbeit zugeschlagen werden, mit der Spezialisten betraut wurden.
Planung
Für den Begriff „Planung“ existieren verschiedene Definitionen. Zusammenfassen lassen sie sich „als geistige Vorwegnahme und Berücksichtigung möglicher zukünftiger Geschehnisse und Gegebenheiten zur Gestaltung von Aktivitäten und Vorbereitung von Maßnahmen zum Erreichen eines gesteckten Ziels“.
Die Planung gehört dabei zu den dispositiven, also „anordnenden“ oder steuernden betrieblichen Produktionsfaktoren. In dieselbe Kategorie fallen Leitung, Organisation und Überwachung.
Beschaffungsplanung
Unter Berücksichtigung der Ausführungen zu Beschaffung und Planung lässt sich die Beschaffungsplanung wie folgt definieren:
Beschaffungsplanung ist die Summe aller Tätigkeiten, Vorgänge und Maßnahmen, die der zielgerichteten Versorgung einer Organisation mit Ressourcen aus externen Quellen dienen, um damit die eigenen Ziele zu möglichst günstigen Konditionen zu erreichen.
Gegenstände der Beschaffungsplanung
Beschafft werden Produktionsfaktoren zur Aufrechterhaltung der betrieblichen Funktionen. Die Produktionsfaktoren können zusammenfassend beschrieben werden als „Ressourcen aus externen Quellen“. Dabei sollte allerdings differenziert werden:
- Im engeren Sinn sind damit die auf den Märkten angebotenen Sachgüter und Dienstleistungen gemeint, es können aber auch Informationen (wie Marktdaten) und Rechte (wie Patente und Lizenzen) einbezogen werden. Je nach Planungshorizont kann bei der Versorgung unterschieden werden zwischen Beschaffungsgütern und Investitionsgütern. Erstere sind kurz- und mittelfristig für die laufenden und absehbaren betrieblichen Prozesse bereitzustellenden, Letztere dienen der langfristigen Ausstattung der Organisation mit Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen oder Immobilien.
- Im weiteren Sinn kann die Beschaffung auch den Finanz- und den Arbeitsmarkt umfassen. Vorrangig sind hier die Kapitalbeschaffung als Sicherung des Zuflusses an finanziellen Mitteln sowie die Personalbeschaffung, das Recruitment, als Aufgabenbereich der Personalwirtschaft.
Ziele der Beschaffungsplanung
Die Beschaffungsplanung hat die Versorgung aller betrieblichen Prozesse mit den zu ihrer Durchführung nötigen Ressourcen zu gewährleisten. Dabei gibt es eine klare Rangfolge, in der die Prozesse bedient werden:
- Absoluten Vorrang haben Kernprozesse der Leistungserstellung. Je nach Organisation sind dies die Produktion, die Fertigung sowie die Be- und Verarbeitung von Sachgütern oder Dienst- und Serviceleistungen. In diesen Bereichen wird die Wertschöpfung vollzogen, die die wirtschaftliche Grundlage des Betriebs ist.
- Wichtig sind aber auch unterstützende Prozesse, die nur indirekt zur Wertschöpfung beitragen, indem sie den Wertstrom im Unternehmen begleiten und zu seiner Lenkung beitragen. Hierzu gehören beispielsweise die Auftragsbearbeitung, die Verpackung oder die Lagerwirtschaft. Auch diese Bereiche müssen anforderungsgerecht mit den entsprechenden Sachmitteln ausgestattet werden.
- An letzter Stelle folgen notwendige, aber nicht wertschöpfende Prozesse. Durch sie ergibt sich kein Mehrwert, sie sind aber für das betriebliche Geschehen unabdingbar. Die Spanne reicht vom Facility Management bis zum Wachdienst.
Oberstes Ziel der Beschaffungsplanung ist, das Risiko kurz- und mittelfristiger Versorgungsengpässe zu minimieren. Dazu ist der Einkauf der voraussichtlich erforderlichen Mengen an Sachgütern und Dienstleistungen zu organisieren. Folgende Aspekte sind dabei zu beachten:
- Die Kosteneffizienz ist zu gewährleisten. Der Einkauf sollte zu möglichst günstigen Konditionen erfolgen.
- Die Wahrung von Qualitätsstandards ist ein Muss. Hier sind nicht nur normative Vorgaben zu erfüllen. Ebenso wichtig ist die Wahrung der Kundenzufriedenheit, um eine Kundenbindung zu erreichen.
- Die Terminierung ist insbesondere für Kernprozesse entscheidend. Nur die rechtzeitige Zurverfügungstellung von Sachgütern und Services, die für die Wertschöpfung notwendig sind, ermöglicht es der Organisation, ihre Leistung erbringen.
- Die Nachhaltigkeit der Maßnahmen rückt immer stärker in den Fokus. Hier stehen der schonende Umgang mit knappen und teuren Ressourcen und die Vermeidung von Verschwendung im Vordergrund.
Aufgaben der Beschaffungsplanung
Die Ziele der Beschaffungsplanung sollten möglichst umfassend und nachhaltig erreicht werden. Dazu sind verschiedene Aufgabenstellungen zu bearbeiten. Deren Spektrum reicht von der Erhebung des Bedarfs – jeweils prozessbezogen in Art und Menge sowie im zeitlichen Verlauf – über die Auswahl der Lieferanten und die Abstimmung der Lieferwege bis zur Festlegung der Lieferstrategie – ad hoc, regelmäßig oder just in time (JIT-Prinzip). Prinzipiell können strategische und operative Aufgaben unterschieden werden.
Zu den strategischen, langfristig ausgelegten Aufgaben gehören zum Beispiel:
- das Erarbeiten und Nachführen eines Beschaffungsportfolios;
- die Analyse des Beschaffungsmarkts anhand von Marktforschungsdaten und anderen Quellen;
- die Entscheidung für eine zentrale und/oder dezentrale Beschaffung;
- das Lieferantenmanagement mit langfristigen Bindungen und gesicherten Konditionen, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten;
- das Einrichten paralleler Beschaffungswege für Ersatzbeschaffungen, um Abhängigkeiten zu minimieren;
- die Initiierung und Etablierung eines Beschaffungs-Controllings;
- die Planung und der Einsatz von IKT (Informations- und Kommunikationstechnik) zur Steuerung und Überwachung der eigenen Logistik und der Supply Chain sowie als Zugang zu (globalen) elektronischen Handelsplattformen (E-Procurement). Zur Logistik gehört beispielsweise der Informationsaustausch und die Nachverfolgung von Sendungen in Echtzeit, die Supply Chain wird unterstützt durch zum Beispiel ein Lagerwirtschaftssystem oder Warenwirtschaftssystem.
Zu den operativen, kurz- bis mittelfristig ausgelegten Aufgaben gehören zum Beispiel:
- die Erfassung der Bestände;
- die Bedarfsermittlung bzw. Bedarfsplanung im Hinblick auf Art, Menge, Qualität und Zeitvorgaben sowie Kosten;
- die Auswahl der Lieferanten und Dienstleister, sofern keine langfristige Bindung besteht;
- das Bestellwesen;
- die logistische Abwicklung.
Fazit: Beschaffungsplanung ist Garant des Leistungsvermögens
Die Beschaffung spielt eine wesentliche Rolle bei der Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Organisation. Ist das Beschaffungswesen gut organisiert und strukturiert, etwa in Form eines strategischen und operativen Beschaffungsmanagements, wird die durchgängige Versorgung eines Betriebs mit den für dessen Zielerreichung benötigten Sach- und Dienstleistungen erleichtert.
Die Beschaffungsplanung hat dabei die Bezugsrisiken zu minimieren, um die Versorgungssicherheit insbesondere für die Kernprozesse der Wertschöpfung langfristig zu gewährleisten und damit die Grundlage der unternehmerischen Leistungsfähigkeit zu festigen. Durch geschickte Auswahl von Lieferanten und das Aushandeln von Bezugskonditionen ist die Beschaffungsplanung ein wichtiges Stellglied bei der Effizienzsteigerung in der Wertschöpfungskette.



