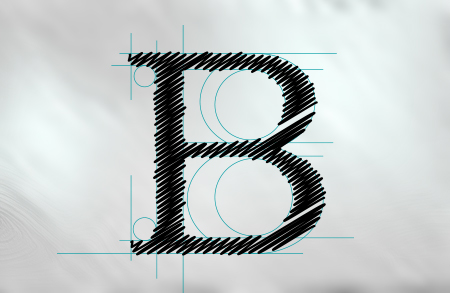
Warum muss bilanziert werden?
Kapitalgesellschaften sind vom Gesetzgeber verpflichtet, die Öffentlichkeit regelmäßig über ihre Vermögensentwicklung zu informieren: Sie müssen ihre Bilanz offenlegen oder zumindest bei definierten Institutionen hinterlegen – das fordert die Offenlegungspflicht. Im Vordergrund steht dabei der Gläubigerschutzgedanke: Dritte sollen durch die Rechnungslegung vor einem möglichen Konkurs des Unternehmens und dem Verlust ihrer Ansprüche geschützt werden. Deshalb unterliegt die Bilanzierung strengen handelsrechtlichen Vorschriften und es gelten die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.
Die Bilanz hat dabei gegenüber internen und externen Stakeholdern – also Interessentengruppen – unterschiedliche Informationsaufgaben:
- Zu den innerbetrieblichen Informationsaufgaben gehört die Feststellung des aktuellen Status, wie die Gewinnermittlung oder die Darstellung der Aktiva und Passiva. Damit ist die Bilanz eine der Grundlagen für Managemententscheidungen.
- Zu den außerbetrieblichen Informationsaufgaben zählt die Information externer Interessenten wie Anteilseignern, Gläubigern, Fiskus und Öffentlichkeit. Hier spielt der Gläubigerschutz mit hinein. Aber auch die Attraktivität als Investment wird deutlich.
Aufbau einer Bilanz
In der Bilanz erfolgt eine in Kontenform ausgeführte Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital, also Aktiva und Passiva eines Unternehmens. Beide Seiten des Bilanzschemas entsprechen insgesamt dem gleichen Wert. § 266 HGB legt die Gliederung der Bilanz für Kapitalgesellschaften fest.
Die Aktivseite der Bilanz, das Vermögen, beschreibt die Verwendung der betrieblichen Mittel und stellt die Gesamtheit aller im Betrieb eingesetzten Wirtschaftsgüter und Geldmittel dar. Das Vermögen wird grob unterteilt in zwei Arten:
- das Anlagevermögen. Es beinhaltet als materielles Anlagevermögen die wertmäßige Erfassung von z. B. Grundstücken, Gebäuden und Maschinen. Das immaterielle Anlagevermögen stellt dagegen auf zum Beispiel Patente und Lizenzen ab. Unter dem Punkt Finanzanlagevermögen werden beispielsweise Beteiligungen oder langfristig angelegte Wertpapiere aufgeführt.
- das Umlaufvermögen. Zu diesem gehören Vorräte wie z. B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Halbfertigwaren und Fertigfabrikate sowie Waren, Forderungen aller Art, kurzfristig angelegte Wertpapiere und Zahlungsmittel, die sich z. B. auf der Bank und in der Kasse befinden.
Die Passivseite der Bilanz beschreibt die Herkunft der betrieblichen Mittel. Hier wird grob unterteilt in Eigenkapital und Fremdkapital:
- Das Eigenkapital stellt den Kapitalbetrag dar, den die Eigentümer eines Unternehmens zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung dem Unternehmen zugeführt oder in ihm belassen haben.
- Das Fremdkapital sind die Schulden des Unternehmens. Sie bestehen aus verschiedenen Arten von Verbindlichkeiten (z. B. langfristige Verbindlichkeiten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) und Rückstellungen (z. B. für Pensionen, Steuern).
Auf beiden Seiten der Bilanz werden gegebenenfalls noch Rechnungsabgrenzungsposten für die periodengerechte Erfolgsabgrenzung ausgewiesen.
Übersteigt die Summe der Aktivposten die der Passivposten, wird ein Bilanzgewinn, im umgekehrten Fall ein Bilanzverlust in Höhe des Differenzbetrags ausgewiesen, sodass die Bilanzsumme auf der Aktiv- und Passiv-Seite stets gleich hoch ist.



