REFA Group - Aktuelles über das Unternehmen

Damit Unternehmen kostenoptimiert und flexibel auf die sich stetig ändernden Erfordernisse des Marktes reagieren können, brauchen sie ein effizientes Produktionscontrolling. Eine Aufgabe dieses Controllings ist die Ermittlung und Zurverfügungstellung notwendiger Kennzahlen. Diese Indikatoren ermöglichen es, das Betriebsgeschehen transparent darzustellen. So können Schwachstellen und Engpässe, aber auch Verbesserungspotenziale identifiziert werden. Dies wiederum ist die Basis für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) – oder, aus Lean-Perspektive, für Kaizen.
Der Managementansatz Lean Six Sigma vereint das statistisch-mathematische Konzept zur Qualitätsverbesserung (Six Sigma, 6 σ) mit dem Lean Management, einem aus japanischen Unternehmen stammenden Ansatz zur Produktivitätssteigerung. Richtig eingeführt und angewendet macht Lean Six Sigma eine Organisation „schlanker“, da die Mitarbeiter in ihrem Bereich Eigenverantwortung übernehmen. Das Ergebnis sind schnellere (Geschäfts-)Prozesse, eine flexiblere Anpassung an die Kundenanforderungen und höhere Qualität.

Die Urlaubsplanung hat zurzeit Hochsaison, der Sommer naht, die Ferien rücken näher. Von einer Extraportion Urlaub träumt da sicher jeder Arbeitnehmer gerne. Und die meisten haben sogar ein Recht darauf – wenn sie ihn zur Weiterbildung nutzen.

Deutsche Krankenhäuser stehen unter Druck: Neben den verstärkten wirtschaftlichen Herausforderungen im Gesundheitswesen beklagen immer mehr Patienten die ineffizienten Abläufe und langen Wartezeiten im Krankenhaus.
Weiterlesen: Lean Hospital: Was Lean Management in Krankenhäusern bewirken kann

Mehr Platz, mehr Komfort, mehr Wohlfühlatmosphäre – mit einem brandneuen Gebäude und umfangreichen Renovierungsarbeiten in den bestehenden Räumlichkeiten schafft die TOP Tagungszentren AG ein Arbeitsumfeld, in dem Eventplanern und Büromietern moderne und flexible Lösungen geboten werden.
Weiterlesen: TOP Tagungszentren AG investiert Millionenbetrag in Neu- und Umbau in Dortmund
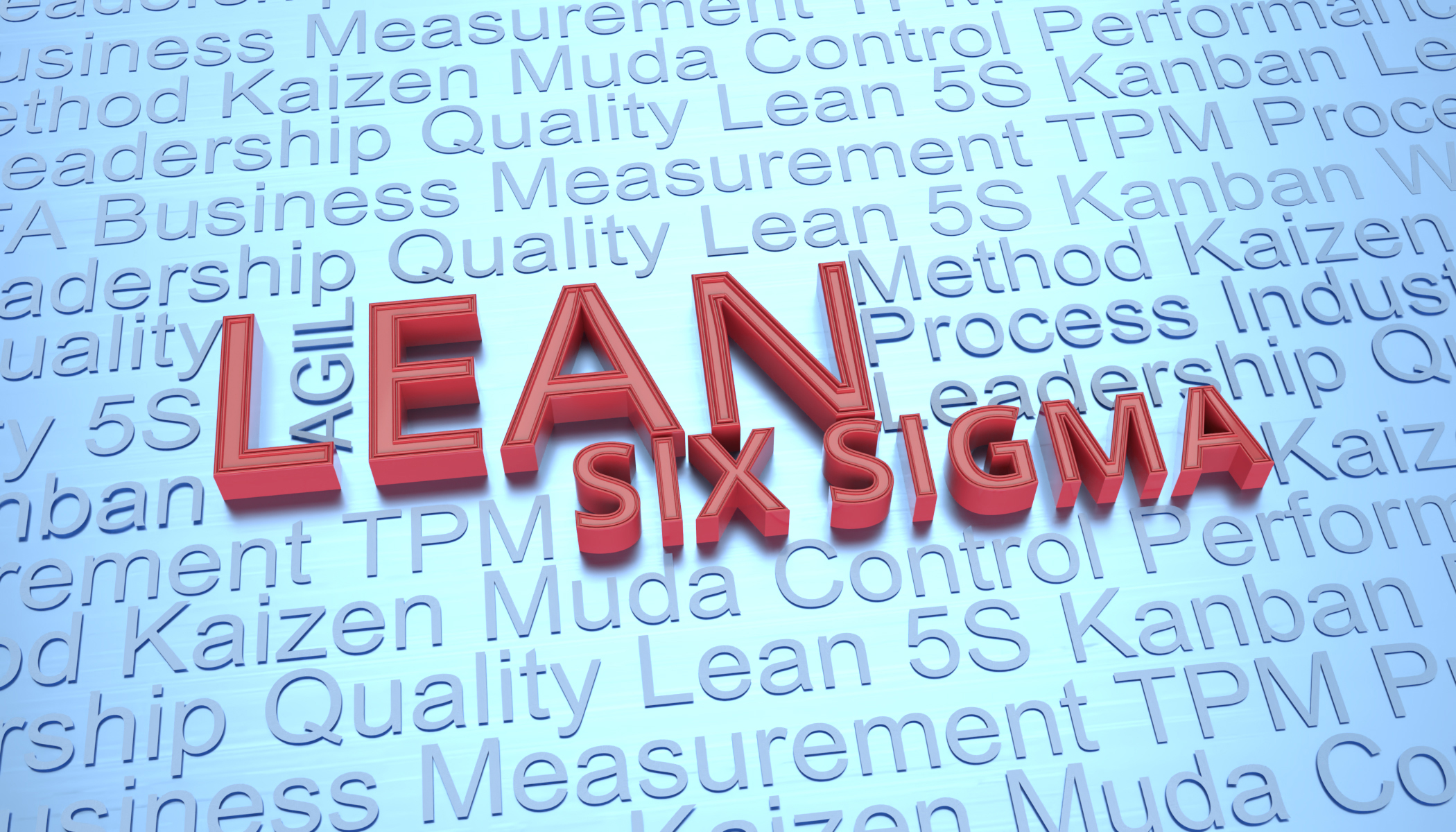
Lean Six Sigma kombiniert Lean Management mit Six Sigma, um das Qualitätsmanagement zu verbessern und Prozesse zu beschleunigen. Das Ziel: Unternehmen sollen Aufgaben schneller und effizienter lösen, ohne die Qualität zu beeinträchtigen, während sie gleichzeitig Mehrwert für die Kunden schaffen. Doch wie kann das in der Praxis die Karriere fördern?

Testen trotz schwindender Maßnahmen
Die meisten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus sind nun aufgehoben: Masken-und Testpflicht fallen beinahe überall weg und Veranstaltungen, auf die wir lange verzichtet haben, finden wieder statt.
Für all diejenigen, die sich weiterhin auf das Coronavirus testen lassen möchten oder müssen, bleibt das Testzentrum im TOP Tagungszentrum Dortmund weiterhin geöffnet.
Weiterlesen: Corona-Testzentrum im TOP Tagungszentrum Dortmund weiterhin geöffnet

REFA AG bei „Digitaler Staat“ in Berlin vertreten
Die Digitalisierung hat längst alle Lebensbereiche erfasst, im privaten und beruflichen Umfeld sind Internet, Messenger-Dienste und soziale Medien weit verbreitet. Auch die Behörden ziehen mit und stellen immer mehr digitale Dienste zur Verfügung. Das Fernziel, der „Digitale Staat“, ist nun Thema einer Konferenz in der Bundeshauptstadt.


