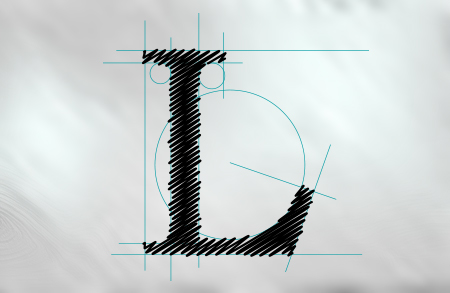
Definition des Lagerbestands
Der Lagerbestand umfasst somit:
- in Handelsunternehmen den Vorrat an Waren und
- in Produktionsunternehmen den Vorrat an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, an halbfertigen und fertigen Erzeugnissen sowie Handelsware.
Zum Lagerbestand zählt auch der sog. "auswärtige Lagerbestand". Das sind Waren, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Erzeugnisse in der logistischen Kette („rollende und schwimmende Ware“).
Bilanzposition
Die im Lagerbestand enthaltenen Güter gehören zum Umlaufvermögen eines Unternehmens und sind auf der Aktiva-Seite in der Bilanz als "Vorräte" zu finden. Da es sich um eine bedeutende Rechengröße handelt, die auch Einfluss auf die Steuerbemessung hat, darf die Höhe des Bestands nicht geschätzt werden, sondern wird mindestens einmal zum Ende des Geschäftsjahres durch eine Inventur oder auch durch eine ständige Notierung aller Zu- und Abgänge festgestellt und in der Bilanz berücksichtigt.
Balance zwischen Lieferbereitschaft und Lagerkosten
Der Lagerbestand findet zudem Ausdruck in Lagerkennzahlen wie Lagerdauer, Lagerumschlag, die als Grundlage für unternehmerische Entscheidungen verwendet werden. Angestrebt wird stets der optimale Lagerbestand, eine Bestandsgröße, die bei einem vorgegebenen Lieferbereitschaftsgrad minimale Gesamtkosten (Lagerkosten, Beschaffungskosten) verursacht. Der Lieferbereitschaftsgrad, auch Servicegrad genannt, drückt die durchschnittliche Lieferfähigkeit des Lagers aus. Liegt der Grad unter 100 %, so ist das Lager nicht immer sofort lieferbereit. Bei der Ermittlung eines optimalen Lieferbereitschaftsgrades sind der notwendige Sicherheitsbestand des Lagerguts ebenso zu berücksichtigen wie die gegenläufigen Tendenzen der Lagerhaltungs- und Fehlmengenkosten.
Das Bestandsmanagement beschäftigt sich mit der Bestandsoptimierung; immer mit dem Ziel, eine optimale Lieferfähigkeit bei gleichzeitig möglichst geringem Lagerbestand zu erreichen.



